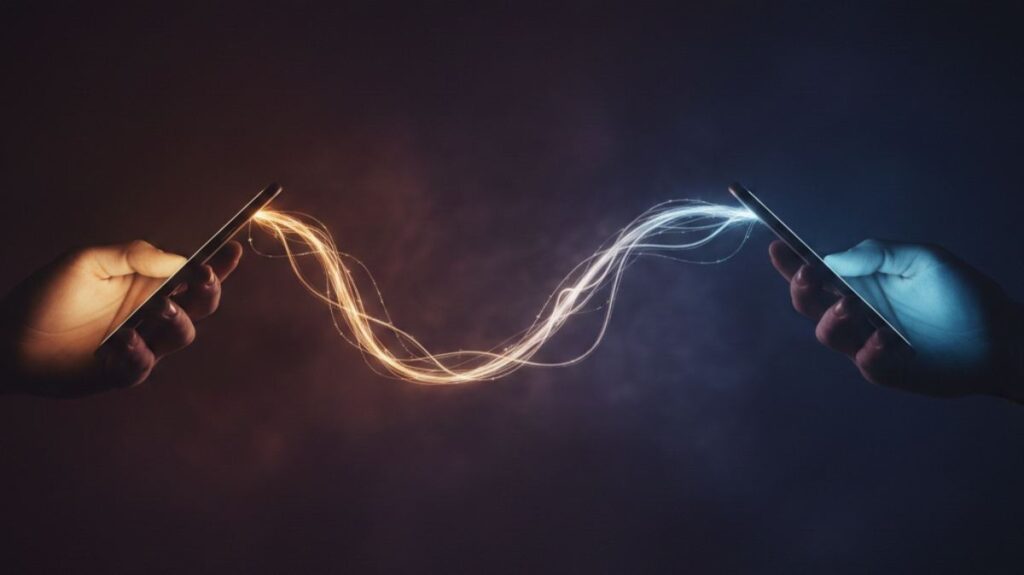Kennt man das Gefühl, kurz bevor das Handy klingelt bereits zu wissen, wer am Apparat ist – und dann recht zu behalten? Dieses alltägliche Erlebnis steht seit Jahren im Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen. Eine im Jahr 2025 veröffentlichte Metaanalyse hat nun 26 Experimente aus zwei Jahrzehnten zusammengefasst und kommt zu einem überraschenden Ergebnis: Die Trefferquoten der Probanden lagen statistisch signifikant über dem Zufallsniveau. Besonders ausgeprägt war der Effekt, wenn Anrufer und Empfänger eine enge emotionale Bindung teilten. Die Studie befeuert eine Debatte, die die Wissenschaft seit Langem beschäftigt.
Das Experiment – Wie Telefontelepathie im Labor getestet wird
Das Grundprinzip der Versuche ist denkbar simpel. Eine Versuchsperson sitzt an einem Telefon ohne Anruferkennung. Vier Menschen aus ihrem Bekanntenkreis stehen als mögliche Anrufer bereit. Für jeden Durchgang wird per Zufallsverfahren einer von ihnen ausgewählt und gebeten, die Versuchsperson anzurufen.
Bevor die Verbindung hergestellt wird, muss die Versuchsperson laut aussprechen, wer ihrer Meinung nach gerade in der Leitung ist. Erst danach wird abgenommen. Bei rein zufälligem Raten wäre eine Trefferquote von 25 Prozent zu erwarten – eine von vier Personen wird schließlich richtig erraten.
Ähnliche Versuche wurden auch mit E-Mails und SMS-Nachrichten durchgeführt. In diesen Fällen sollten Teilnehmende den Absender einer eingehenden Nachricht benennen, bevor sie diese öffneten. Das Design wurde im Laufe der Jahre von verschiedenen Forschungsgruppen übernommen und weiterentwickelt, unter anderem durch automatisierte Abläufe, bei denen computergestützte Systeme den Zufallsprozess kontrollierten.
Die Ergebnisse – Klein, konsistent und statistisch bedeutsam
Die im Journal of Anomalous Experience and Cognition erschienene Metaanalyse fasste 15 veröffentlichte Studien mit insgesamt 26 Einzelexperimenten zusammen, die zwischen 2003 und 2024 durchgeführt wurden. Die Autoren – der britische Biologe Rupert Sheldrake, Tom Stedall vom Schumacher Institute in Bristol sowie Patrizio Tressoldi von der Universität Padua – verwendeten ein sogenanntes Random-Effects-Modell, das die unterschiedlichen Studiendesigns statistisch berücksichtigt.
Das Gesamtergebnis: Die Trefferquoten lagen hochsignifikant über dem Zufallsniveau, mit einem p-Wert von 1 × 10⁻⁷ – das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis rein zufällig zustande kam, beträgt weniger als einer von zehn Millionen. Anders ausgedrückt: Die beobachteten Abweichungen vom Zufall sind statistisch außerordentlich unwahrscheinlich.
Ein wichtiges Qualitätsmerkmal der Analyse ist, dass die Ergebnisse unabhängiger Replikationen – also Versuche, die von anderen Forschungsgruppen unter anderen Bedingungen wiederholt wurden – nicht wesentlich von den ursprünglichen Studien abwichen. Die Effekte erwiesen sich zudem als stabiler als in vergleichbaren Ganzfeld-Experimenten zur außersinnlichen Wahrnehmung, bei denen Probanden in sensorischer Abschirmung Bilder zu identifizieren versuchen.
Zum Nachlesen: Was ist ein p-Wert?
Der p-Wert gibt an, wie wahrscheinlich ein beobachtetes Ergebnis wäre, wenn rein der Zufall wirkt. Ein p-Wert unter 0,05 gilt in der Wissenschaft üblicherweise als statistisch signifikant. Der in dieser Metaanalyse gemessene Wert von 1 × 10⁻⁷ liegt weit darunter und entspricht einer Wahrscheinlichkeit von 0,00001 Prozent, dass das Ergebnis auf Zufall zurückgeht.
Rupert Sheldrake – Forscher zwischen Faszination und Skepsis
Rupert Sheldrake ist eine der schillerndsten Figuren der Grenzwissenschaft. Der promovierte Biologe, der an der Universität Cambridge forschte, vertritt die These, dass Telepathie keine übernatürliche Ausnahmeerscheinung ist, sondern ein normaler, evolutionär entstandener Mechanismus sozialer Kommunikation. In seinem Buch „Dogs That Know When Their Owners Are Coming Home“ dokumentierte er ähnliche Phänomene bei Tieren.
Sheldrake ist innerhalb der Wissenschaftsgemeinde umstritten. Kritiker werfen ihm vor, Ergebnisse zugunsten seiner Hypothesen zu interpretieren und Studien methodisch nicht ausreichend abzusichern. Sein Name taucht regelmäßig in Debatten über die Grenze zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft auf.
Die aktuelle Metaanalyse hat Sheldrake deshalb bewusst mit unabhängigen Ko-Autoren verfasst. Patrizio Tressoldi gilt in der Parapsychologie-Forschung als methodisch strenger Wissenschaftler, der an der Universität Padua lehrt und regelmäßig in Fachzeitschriften publiziert. Das die Ergebnisse beider Gruppen – Sheldrakes eigene Studien und unabhängige Replikationen – statistisch nicht voneinander abwichen, ist für die Autoren ein wichtiges Indiz für die Belastbarkeit der Daten.
Was die Ergebnisse bedeuten – und was nicht
Eine statistisch signifikante Abweichung vom Zufall ist nicht dasselbe wie ein Beweis für Telepathie. Diese Unterscheidung ist zentral für das Verständnis der Studie. Die Wissenschaft kann aus diesen Daten nicht schlussfolgern, dass Gedanken direkt von einem Gehirn zum anderen übertragen werden.
Denkbar sind verschiedene alternative Erklärungen. Subtile Reize, die Versuchspersonen unbewusst wahrnehmen, könnten ihre Einschätzung beeinflussen – auch wenn das Studiendesign solche Kanäle explizit ausschließen soll. Publikationsbias, also die Tendenz, positive Ergebnisse häufiger zu veröffentlichen als negative, ist ein bekanntes Problem der Forschungslandschaft. Allerdings gehen Tressoldi und Sheldrake in einer separaten Analyse aus dem Jahr 2025 davon aus, dass Publikationsbias in der Parapsychologie nicht stärker ausgeprägt ist als in der Mainstream-Psychologie.
Bemerkenswert ist ein weiteres Ergebnis der Metaanalyse: Wenn die Experimente unter sogenannten präkognitiven Bedingungen durchgeführt wurden – also wenn Probanden erraten sollten, wer in der Zukunft anrufen wird, ohne dass zum Zeitpunkt des Ratens ein Anruf stattfand –, lagen die Trefferquoten auf Zufallsniveau. Das legt nahe, dass der gemessene Effekt nicht auf allgemeine Ratetendenzen zurückzuführen ist.
Emotionale Nähe als entscheidender Faktor
Eines der konsistentesten Muster in der Metaanalyse ist der Zusammenhang zwischen emotionaler Bindung und Trefferquote. Versuchspersonen, die eine enge Beziehung zu den möglichen Anrufern hatten – etwa Familienmitglieder, enge Freunde oder Lebenspartner – erzielten deutlich bessere Ergebnisse als solche, die weniger persönliche Verbindungen zu den Testpersonen hatten.
Dieser Befund deckt sich mit Beobachtungen aus dem Alltag. Umfragen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen, die berichten, telepathische Erlebnisse gehabt zu haben, diese in Zusammenhang mit nahestehenden Personen beschreiben – selten mit Fremden. Das Phänomen scheint an soziale Nähe gebunden zu sein.
Ebenfalls auffällig: Vorab ausgewählte Teilnehmende, die bereits Erfahrung mit solchen Versuchen hatten oder von sich selbst glaubten, intuitiv zu sein, erzielten signifikant höhere Trefferquoten als zufällig rekrutierte Probanden ohne entsprechende Vorannahmen. Diese sogenannte „Schaf-Ziege-Differenz“ – benannt nach dem Unterschied zwischen Gläubigen und Skeptikern – ist ein bekanntes Muster in der Parapsychologie-Forschung.
Die Ergebnisse laden dazu ein, alltägliche Erlebnisse neu zu betrachten: Jener Moment, in dem das Telefon klingelt und man bereits weiß, wer dran ist, bleibt wissenschaftlich ungeklärt – aber er ist offenbar häufiger als der Zufall es erwarten lässt.
Weiterführende Quellen
- Sheldrake, Stedall & Tressoldi (2025): Telecommunication Telepathy – A Meta-Analysis (Journal of Anomalous Experience and Cognition)
- Rupert Sheldrake: Wissenschaftliche Publikationen zur Telepathie-Forschung
- Volltext der Metaanalyse als PDF (Journal of Anomalous Experience and Cognition)
- Psychology Today: Anomalous Cognition und neue Forschungsperspektiven (Okt. 2025)
Tom ist der Hauptautor von beachtenswert.info und freut sich immer über Feedback. Mit journalistischer Erfahrung seit 2012, als Buchautor aktiv und mit großer Passion für das Weltenbummeln (mit Betonung auf Bummeln.)